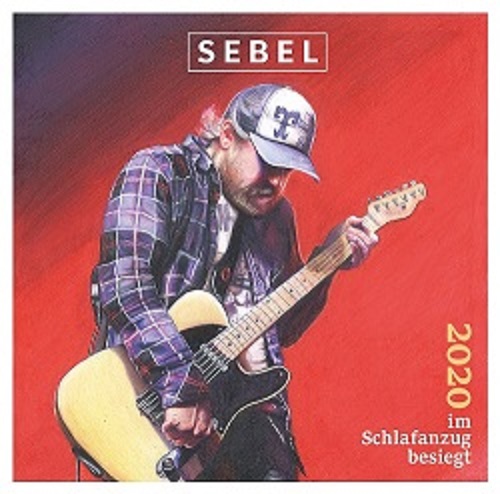PASCOW – Sieben

Pascow gelten nicht gerade als die schnellste Band, wenn es darum geht, ein neues Album aufzunehmen. Häufig liegen vier oder fünf Jahre zwischen zwei Platten. Auch diesmal ist es so. Vier Jahre nach „Jade“ erscheint mit „Sieben“ ihr neuer Longplayer, der seinen Namen schlicht und ergreifend von der Anzahl ihrer Studioalben hat.
Die sieben ist zugleich aber auch eine mythische und bedeutungsschwangere Zahl in der Kultur des Abendlandes – und das nicht nur wegen Schneewittchen. Das passt gut zu Pascow, denn von je her haben sie viel Wert auf Texte und Meinung gelegt. Ab und an wird ihnen dabei vorgeworfen sich für eine deutschsprachige Punkband zu kompliziert und zu intellektuell auszudrücken. Gestört hat sie diese Kritik nie, wenn auch auf „Jade“ die Lyrics etwas leichter zugänglich und deutlich verständlicher wurden. Die aus dem rheinland-pfälzischen Gimbweiler stammende Truppe knüpft auf „Sieben“ nahtlos daran an. Weniger inhaltsreich sind sie deswegen nicht. Es geht um gesellschaftliche Themen wie Gentrifizierung, Rechtspopulismus, Umweltzerstörung, Armut, Außenseitertum und natürlich gesellschaftliche Veränderung. Der ein oder andere unkitschige Liebessong dafür natürlich auch nicht fehlen.
Pascow wären jedoch nicht Pascow, wenn sie nicht in ihren Texten immer wieder Stellen hätten, die man sich am liebsten ausschneiden und einrahmen oder gleich an die nächste Häuserwand schreiben möchte. Das ist auf „Sieben“ keineswegs anders:
„Wenn die Städte alle gleich sind, geh’n wir nicht mehr hin, denn sie sind öde wie ein Mond, Wo gestern Nacht ein Junkie stand ist jetzt ’ne Juicy Bar“, „Dein Vater war gut im Spielen,
meiner gut im Abhauen. An manchen Ort lernt man schnell Idyllen nicht zu trauen“ „Lügen haben keine Beine, aber viel zu lange Arme“ „Alle Märchen leben von denen, die an sie glauben“, „Du wurdest nie das was du solltest, nur das, was du jetzt bist“, „Und dort das Bild einer Zukunft in Frieden, zerrissen in Minuten als die Bomben fielen“.
Musikalisch bleiben Pascow ihrem Stil des größtenteils schnellen, aber melodiösen Punkrocks treu. Im Vergleich zum Vorgänger wirkt „Sieben“ jedoch etwas geradliniger und rauer. Vor allem „Monde“ oder „Vierzehn Colakracher“ symbolisieren dies. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine abwechslungsreichen Elemente oder neue Nuancen gibt. Der Beat und der melodiös-hymnische Choreinsatz von „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ oder die Streicher in „Mailand“ überraschen selbst beim zweiten und dritten Hören.
Es ist faszinierend, wie Pascow ohne die ganz großen Entwicklungssprünge ihren Stil konsequent auf höchstem Niveau durchziehen. Negative Aspekte an „Sieben“ zu finden fällt deswegen schwer. Die Songs sind einfach zu gut gemacht und textlich waren Pascow schon immer über jegliche Kritik erhaben. Somit wirft das Quartett gleich zu Beginn des Jahres ein Album auf den Markt, welches ein ganz großer Kandidat für die beste deutschsprachige Platte 2023 ist