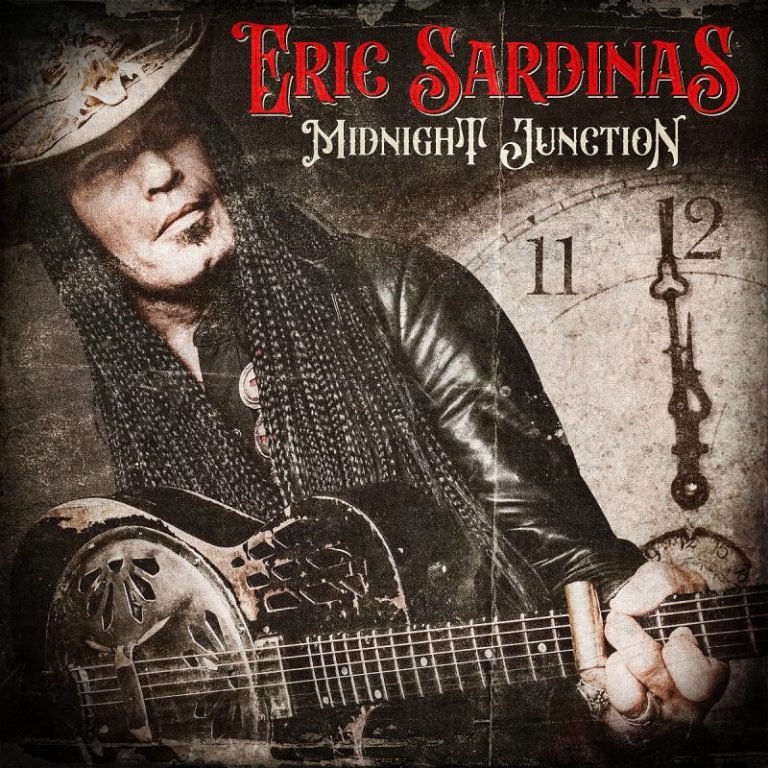Distance Over Time

Dream Theater haben 2019 tatsächlich verlorenen Boden gutzumachen. Nach zwei relativ mittelprächtigen Alben, die die Band seit dem Ausstieg ihres – auch als Songwriter für die Band extrem wichtigen – Drummers Mike Portnoy aufgenommen hatte, gab es zum letzten Album „The Astonishing“ einen regelrechten Backlash. Das musikalisch sehr an Broadway-Musicals orientierte Album vergraulte selbst ein paar der treuesten Fans und wurde von der Kritik mit Spott überzogen.
Wie gesagt, das soll sich nun alles ändern. Zurück zum progressiven Metal, so hieß schon im Vorfeld die Marschrichtung. Die beiden vorab veröffentlichten Songs ‚Fall Into The Light‘ und ‚Paralyzed‘ schienen das auch zu bestätigen – speziell das erstere Stück ließ durchaus Erinnerungen an die Bandklassiker aufkommen. Um den Spoiler mal vorwegzunehmen, man muss der Band bescheinigen, dass „Distance Over Time“ tatsächlich das Beste ist, was sie seit Portnoys Abgang veröffentlicht hat – vielleicht sogar schon länger. Auch wenn die Scheibe genau einen einzigen Überraschungsmoment beinhaltet (siehe weiter unten), bieten Dream Theater endlich wieder grundsolide „Dream Theater spielt Dream Theater“-Kost. Produktionstechnisch hat man sich ein wenig von der sterilen Kälte der letzten Alben entfernt. Vor allem ist endlich mal wieder John Myungs Bass, die Geheimwaffe der Band, deutlich herauszuhören. John Petrucci bleibt John Petrucci – wie erwartet. Schön breiige Riffs, wieselflinke Soli mit dem bekannten gelegentlichen Hang zum selbstverliebten Gedudel und einigen echten Geniestreichen – alles beim Alten. Jordan Rudess dudelt genauso gnadenlos und bisweilen eher unmelodisch wie er sich das seit (mindestens) „Octovarium“ angewöhnt hat, steuert aber auch wieder ein paar großartige Elton John-Pianoparts bei. Der Drumsound ist einmal mehr so künstlich-steril ausgefallen wie Mike Manginis alle Progmetal-Klischees bedienende Spielweise. Aber! Wer, wenn nicht Dream Theater, hätte denn ein Recht auf all diese Klischees? Und tatsächlich hat die Band diesmal einige für ihre Fans durchaus hörenswerte Songs zustandegebracht. Neben dem Opener ‚Tethered Angel‘ muss vor allem das an „Scenes From A Memory“ (!) oder gar „Awake“ erinnernde ‚At Wit’s End‘ erwähnt werden, das vor allem live so richtig Spass machen dürfte und einen verdammt guten Set-Opener abgeben würde. Das nach Spass im Studio klingende Synthie-/Gitarrenduell im Mittelpart ist genau der Stoff, den man als Fan von Dream Theater haben will, bevor ein pianogetragenes Finale mit einem pathosbeladenen, singenden Petrucci-Trademark-Solo eingeleitet wird. ‚Fall Into The Light‘ ist ein typisches Petrucci-Epos mit diversen Anklängen an „When Dream And Day Unite“ und (gesanglich) „Falling Into Infinity“. Auch das ebenfalls etwas härter und instrumental ziemlich exzessiv ausgefallene ‚Pale Blue Dot‘ weiß zu gefallen. auch wenn man sich aufgrund der deutlich an dessen Siebziger-Werke erinnernden Gesangslinie gewünscht hätte, Kollege Alice Cooper hätte einen Gastbeitrag abgeliefert.
Aber auch James LaBrie zeigt sich – wie auch auf dem Rest des Albums – von seiner besten Seite und bleibt fast durchweg in den mittleren Lagen, in denen er auch heute noch durchaus überzeugend klingt. Dass er die hohen Töne im lockeren, Boogie-infizierten (!) und sehr coolen, weil komplett ungewohnten ‚Viper King‘ hingegen live schaffen wird, ist kaum zu erwarten. Schade, denn der Song ist gerade aufgrund seiner beinahe Van Halen-artigen Coolness eines der Highlights des Albums – auch wenn das die Musikerpolizei eventuell anders sehen wird. Scheiden werden sich die Gemüter auch an ‚Barstool Warrior‘, das entgegen des martialischen Titels ein wenig zu stark versucht, in die Kerbe der poppigen „Images And Words“-Songs wie ‚Another Day‘ und vor allem ‚Surrounded‘ zu schlagen und dabei ähnlich kitschverliebt zu Werke geht wie der Großteil von „The Astonishing“. Auch ‚Out Of Reach‘ ist eine unspektakuläre AOR-Ballade, die klar in die Richtung von ‚Hollow Years‘ und ‚The Silent Man‘ zielt, ohne deren Klasse zu erreichen.
Ist „Distance Over Time“ also das große Comeback der Band geworden, Chuck Norris‘ Rückkehr sozusagen? Nun, nicht ganz. Dafür hat die Konkurrenz Dream Theater in Sachen Frische, Songwriting und, ja, Progressivität zu weit überholt. In den besten Momenten des Albums zeigen die Urväter aber, dass ihnen durchaus bewusst ist, wo die Messlatte liegt – doch die erreicht „Distance Over Time“ nicht immer. Aber, um das mal zu relativieren und vor allem nicht alles schon wieder an Nach-neun-Jahren-immer-noch-Neu-Drummer Mike Mangini festzumachen: schon seit „Train Of Thought“ und „Octovarium“ stieg die Füllmaterial-Quote auf Dream Theater-Alben ein wenig an, und qualitativ kann sich „Distance Over Time“ durchaus auf deren Niveau festbeißen. Wenn es auch nicht reicht, mit den heutigen Genrevorreitern oder gar den eigenen Klassikern der Achtziger (doch!) und Neunziger zu konkurrieren, Dream Theater liefern 2019 grundsolide Arbeit ab und toppen die mit ein paar wirklich exzellenten Ausreißern nach oben.