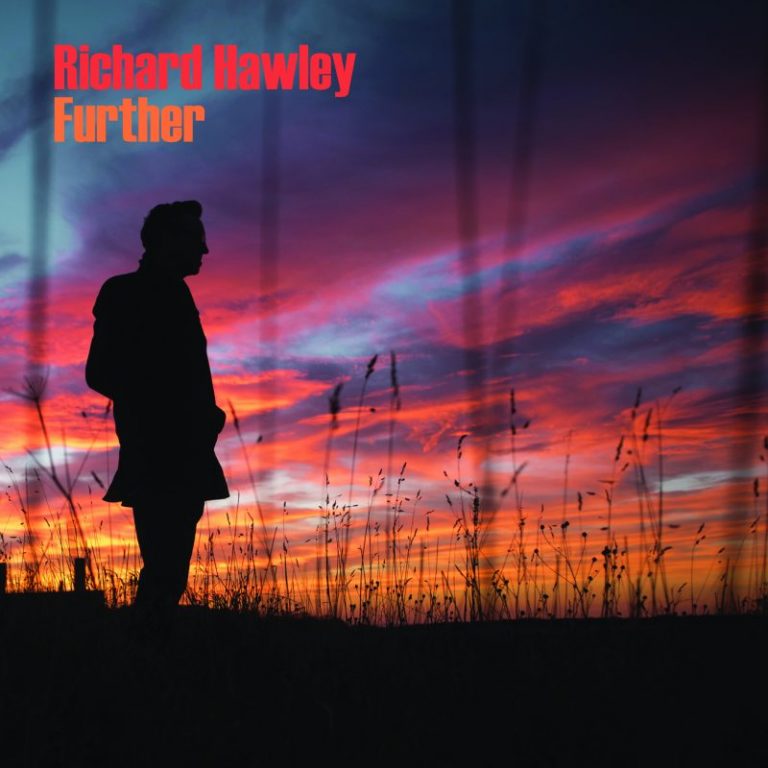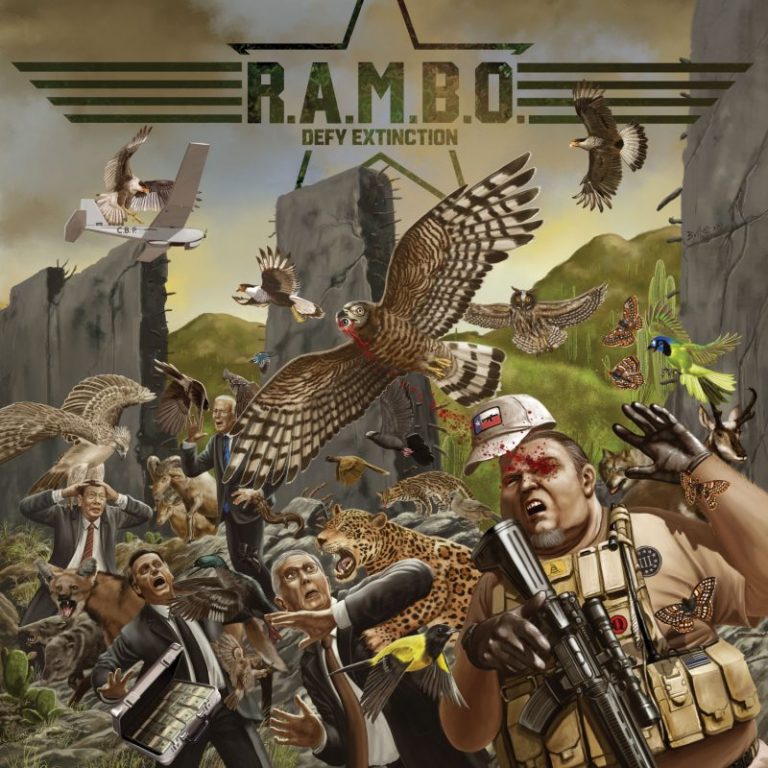The Making Of

Vor einem Jahr noch sorgten The Bohicas mit ihren Songs ‚XXX‘ und ‚Swarm‘ für ordentlich Wirbel. Die schrammeln noch derbe auf den Gitarren, die hauen einem schmissige Basslines um die Ohren, die strotzen so richtig vor Energie. Geblieben sind ein paar gute Songs, und eine zähe Masse, die sich nicht aussuchen kann, ob sie eher wie die Arctic Monkeys, Kasabian, die Rolling Stones oder eben doch Royal Blood klingen mag. ‚The Making Of‘ ist somit tatsächlich ein wahres Making of. Als wollten sie die neue englische Superband gründen, vermengen sie 50 Jahre erfolgreiche Insel-Musikgeschichte. Leider verlieren The Bohicas auch so das große Eigene. Denn was das ist, lässt sich kaum herausfinden.
The Bohicas, das sind vier Londoner, alle aus dem Ei gepellt, als wären sie gerade dem ‚This Is England‘-Cast entrollt. Durchgestyled bis zum kleinen Zeh ertönt auch ihr Sound. 60s, 70s,80s, 90s – das Quartett kann alles! Eigene Ideen fehlen hingegen. Tiefe und knatschende Gitarren auf ‚To Die For‘ paaren sich mit lässigen Rhythmen, die – sorry, Jungs! – sofort an eine leidenschaftslosere Version der Arctic Monkeys erinnern. Die tiefen und brodelnden Bassläufe, die sich im Laufe des Hörens als ihre Handschrift mausern, stehen denen von Royal Blood in nichts nach. Selbst die Grenze vom Rock zum Pop können sie bedienen und zeigen mit ‚Only You‘ und ‚Girlfriend‘, dass sie erprobt im Harmoniegesang sind. Aber so wie ihre vier Lederjacken perfekt zu den fetten Boots passen, stellt sich auch zu den geschniegelten Songs die Frage nach dem, was an diesem Album schlussendlich faszinieren soll. Erschwerend kommen die weichgespühlten Lyrics hinzu, die höchstens noch die 16-jährigen Lads auf dem Schulhof begeistert.
‚So where are you going girlfriend? / And you still won’t pick up the phone / Location unknown / Where do you go?‘
(‚Girlfriend‘)
Am Superband-Sound müssen die Jungs noch feilen, sonst ziehen sie weiterhin den kürzeren gegenüber den großen Brüdern. ‚The Making Of‘ ist zu leidenschaftslos, um richtig was zu reißen. Einigen Songs hört man das Potenzial an. Gerade zum Schluss, wenn die galoppierenden Drums auf die dunklen, verspielten Gitarren treffen (‚Upside Down And Inside Out‘), springt der Funke fast über. Allerdings nur fast, den netten Rest kann man darüber einfach nicht vergessen. Jetzt ist es an der Zeit an den tiefbrodelnden Bässen zu arbeiten, dann haben sie zumindest ein solides Markenzeichen für das nächste Album gefunden.