Ten Love Songs
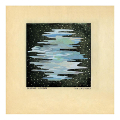
So ein Pech aber auch. Da holt Susanne Sundfør zum großen Gewalt-Album aus, und die Verflechtung der Wahrheiten dieser Welt macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Gewalt klebt eben nicht selten mit Gefühlen zu anderen Menschen im Allgemeinen und der Liebe im Speziellen zusammen. Am Ende stehen zehn Lieder über Liebe, mehr über- denn umschrieben mit dem pragmatischen Titel ‚Ten Love Songs‘. Auf dem Blatt: Langeweile pur – und ein triftiger Grund, an dieser Stelle sofort das Lesen einzustellen. Wäre aber ein Fehler. In Wirklichkeit nämlich zählt auch das dritte Album der Norwegerin mit zum Aufregendsten, was das Genre in den vergangenen Jahren erleben durfte – trotz leichten Gefälles mit Blick auf die um ein Quäntchen ausgefeilteren Vorgänger.
‚I hope you got a safety net / ‚Cause I’m gonna push you over the edge‘
, würde die Künstlerin im siebten von zehn Tracks praktisch schon zu spät warnen, spräche sie zu ihrem Hörer.
Hinter ‚Ten Love Songs‘ verbirgt sich kein halbherziges Allerwelts-Konzeptwerk und schon gar kein akustischer Album-Halbling mit biederen Schmuseballaden. Solche Vermutungen und Verdachtsmomente siebt Susanne Sundfør gleich zu Beginn aus – und mit ihnen auch die landläufigen Erwartungen an die Liebe – zu hören in einer Ouvertüre namens ‚Darlings‘.
Denn immerhin treibt die ewig junge Norwegerin auf dem dritten (ja angeblich karrieredefinierenden) Album ihre stilistische Zerrissenheit auf die Spitze. Kühle, von erstrahlenden Synthie-Säulen flankierte Eisprinzessin mit nahezu unwirklich reiner, glatter Stimme auf der einen, verträumtes, streicherumschwirrtes Sterntalerchen in kindlicher Erregung auf der anderen Seite – Sundfør kann sich entweder noch immer nicht enscheiden, oder aber sie will beides sein, so wie sie in ‚Trust Me‘ sowohl den Onkel Doktor als auch den Heiligen als Helfer zur Unglücksstelle bemüht. Entsprechend impulsiv treffen pressende, düstere Tanzrhythmen auf metrumbefreiten Orchestral-Äther. Letzterer beansprucht bisweilen ganze Landschaften für sich und dehnt das Stück ‚Memorial‘ auf zehn klavier- und streichergeschwängerte Minuten vollmundiger Klassik aus.
‚Fade Away‘ und ‚Slowly‘ hingegen haben sich die Perlen der 80er-Disko gegriffen und werfen sie mit einer Hand am Keyboard vor die Säue, während ‚Insects‘ an den Schalen des perkussiven Futurismus‘ knuspert. In Versen klingt die kosmisch-transzendentale Cyborg-Schnulze dann so:
‚Blasting, blazing, stars exploding / The cosmic war, raging in the sky / But all I could hear was your last goodbye.‘
Eindrücke, unter deren Zwiespalt schon mal eine Gitarre zur Harfe gerät. Oder eine Orgel zur Höllenmaschine. Überhaupt ist diese verdammte Orgel der heimliche Hauptdarsteller der Platte. Großmäulig-opulent mischt sie sich ein und pustet aus vollem Rohr Löcher in die ohnehin schon turbulente Partitur.
‚Let’s have fun / Let’s have fun‘
, singt Sundfør diabolisch verdüstert darüber, scheinbar mit einem Mal der Unschuld entledigt. Und wieder ist alles gefährlich offen.
Wenn sich etwas so mehrdeutig, so unbequem und verführerisch, so verderbt und so sakral zugleich anfühlt wie die Musik auf diesem Album, dann kann es sich fast nur um Liebe handeln. Liebe kann beflügeln, Liebe kann lähmen, ist heute turbulent und morgen zäh – und sie kann einen ziemlich krasse Dinge tun lassen. Ein Album aufnehmen, zum Beispiel. Susanne Sundfør wird es mittlerweile wissen: Liebe wohnt nicht Tür an Tür mit der Gewalt – sie ist es selbst. So ein Glück aber auch.





