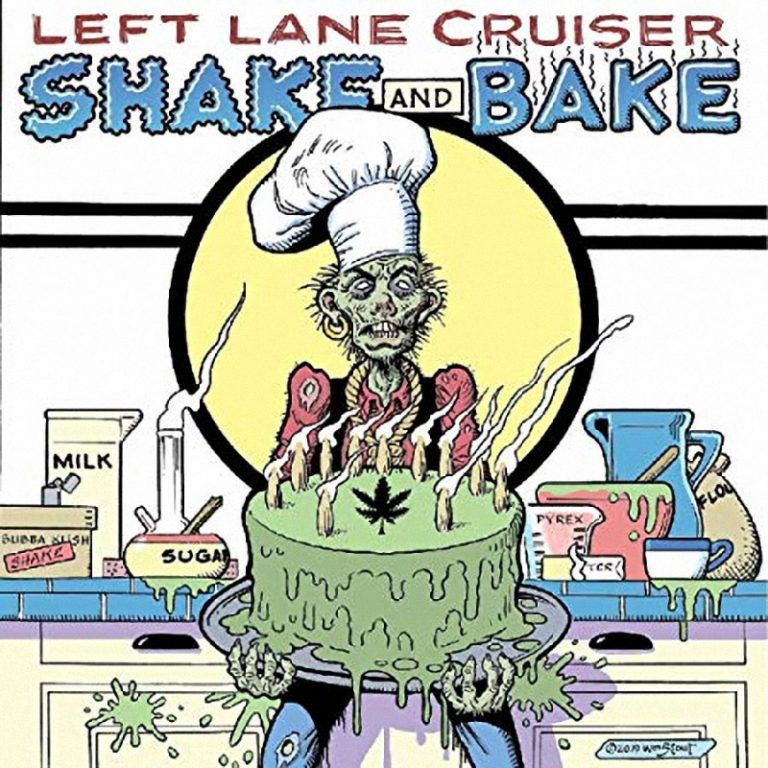One Desire

Seit einiger Zeit ist es im Schweden-AOR und -Hardrock ziemlich üblich, die Produktionsmethoden und Hookline-Strategien von Hitmaschinen wie Andreas Carlsson oder Max Martin zu kopieren, bis die Schwarte kracht. Wenig verwunderlich, haben doch nicht nur Britney Spears, Katy Perry, Backstreet Boys und Taylor Swift, sondern auch Acts wie Bon Jovi, Europe, Paul Stanley bereits auf deren Dienste zurückgegriffen. Und Max Martin selbst ist bekennender Iron Maiden-Die Hard-Fan und hat vor seinen Hitmachertagen als „Max White“ bei der schwedischen Hardrockband It’s Alive gesungen.
Wenn’s allerdings so einfach wäre. Denn Autotune/Melodyne, Hall und Synthieflächen machen eben noch lange keinen Hit, und selbst die richtigen Hooklines reichen nicht aus, um TayTay und Ariana Grande die Teenie-Fans streitig zu machen. Man nehme die schrecklich gehypten Eclipse, um zu sehen, wie nervtötend das Ergebnis werden kann, wenn man nicht das freche Charisma hat, um damit durchzukommen. Nun, um mal zum Kern dieser Rezi zu kommen, One Desire schlagen sich da klar besser. Denn nichts auf deren Debütalbum klingt auch nur annähernd, als ob die Jungs als Rock-Band ernstgenommen werden wollten. Nein, One Desire passen sich da eher zwischen One Republic und One Direction ein. Das hier ist bewusst ein lupenreines Popalbum, selbst das von einem härteren Riff getragene Uptempostück ‚Buried Alive‘, das tatsächlich leicht nach Pretty Maids klingt, hat keinerlei Ecken und Kanten oder gar rock’n’rollige Bodenständigkeit. Die Gitarren sind irgendwo zwischen den Millionen Synthiespuren so eingebettet, daß mit Sicherheit nichts wehtut, und in Songs wie ‚Love Injection‘ und ‚Falling Apart‘ könnten auch zwölfjährige Schulmädchen glatt schwach werden – wenn die Typen denn halb so alt und weniger häßlich wären. Immmerhin sind One Desire konsequent in ihrer musikalischen Ausrichtung.
Aber, um den Ansatz wieder aufzunehmen: taugt „One Desire“ nun was oder nicht? Nun, gut die Hälfte der Songs bleiben durchaus hängen, und das ist ja im Pop schon einmal ein gutes Zeichen. Allerdings schafft es die Band zu keiner Zeit, eine eigene Identität zu projizieren. Und genau da sind ihnen Pop-Sängerinnen wie Taylor Swift, Katy Perry oder eben auch Bon Jovi immer noch einige Schritte voraus. Denn, um beim Hörer einen Eindruck zu hinterlassen, muss immer ein wenig von der Persönlichkeit des Künstlers durch den ganzen Zuckerguß und die Plastikfolie durchscheinen. „One Desire“ wirkt leider trotz aller guten Ansätze eher etwas bemüht, ein wenig aufgesetzt und gesichtslos. Keinesfalls ein wirklich schlechtes Album, aber eben nur Schweden-Pop-Stangenware mit Alibigitarren. Vielleicht beim nächsten Mal.