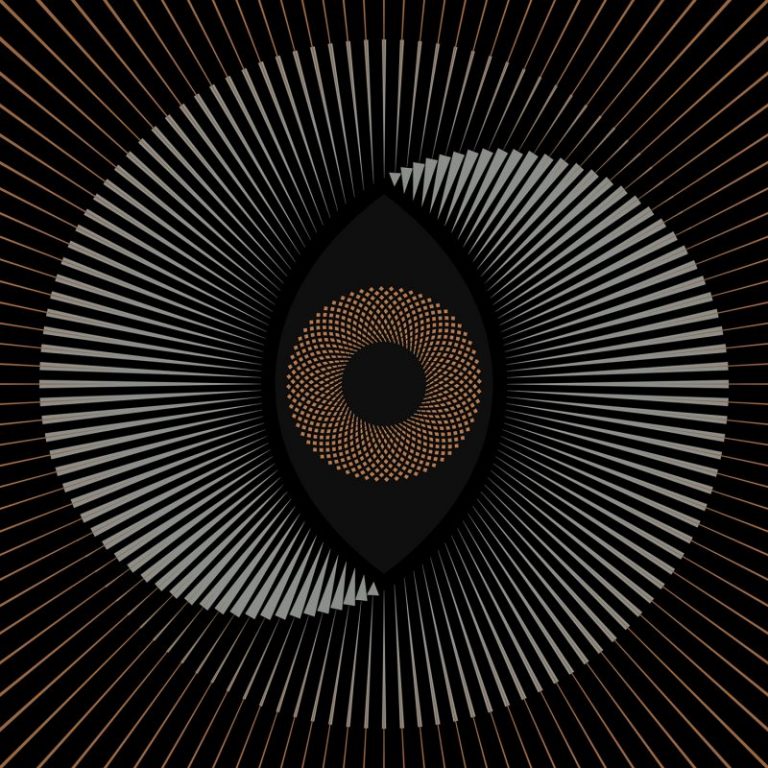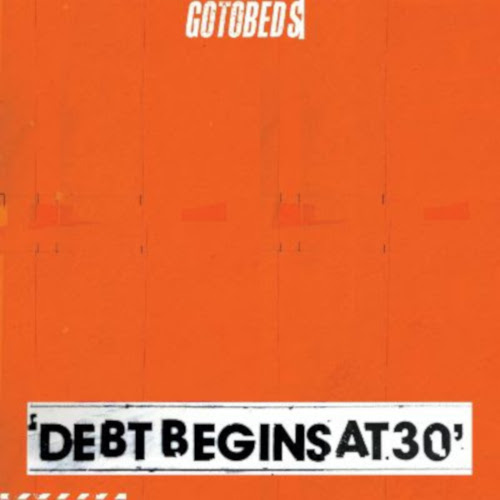The Ark Work

So häufig Schaubilder oder Diagramme einem auch die Sicht klären mögen – manchmal stiften sie nur noch mehr Unklarheit. Liturgy mögen diese Art des Verwirrspiels. Mindestens so sehr, wie sie Bildungssprache mögen. Und wenn selbst die nicht langt, brauen sie sich nach Belieben ihre Ausweichtermini. Sind die erst zueinander in Beziehung gesetzt, schreiben sie sie sortiert bis angeordnet nieder. In Großbuchstaben. UNGEFÄHR SO. Nein – EHER SO.
Sicherlich weniger, um ihren Hörern damit eine Gefälligkeit zu erweisen, als vielmehr einfach, weil sie abgehoben genug sind, es sich erlauben zu können. Was zum Beispiel ‚Ylylcyn‘ bedeutet oder wer ‚Ololon‘ ist, weiß außer Hunt Hunter-Hendrix vermutlich kein Mensch, dem nicht zufällig einmal William Blake in den Schoß gefallen ist. Dem Kopf von Liturgy ist das herzlich egal; seinen Vorsprung in Sachen Erleuchtung scheint er zu genießen. Nicht, dass die in trven Kreisen vielgescholtene Metal-Mimikry im Hipsterhemd es nicht mit mehreren Gegnern zugleich aufnehmen täte, aber Wichtigster unter jenen ist eben der eigene Hörer, und den gilt es Album für Album neu zu bezwingen – je triumphaler, desto besser. Unter diesem Blickwinkel kommt ihr drittes (und sicherlich übergeschnapptestes) Album ‚The Ark Work‘ einer Unterwerfung gleich.
Ganz ohne Gutturalgesang diesmal, dafür aber mit schamanischen Riten, Afrobeat-Rhythmen und ewigen MIDI-Trompetenfanfaren, die vom Einzughalten grausamer Majestäten zu künden scheinen. Liturgy entwinden sich ihrem Rezipienten, nur um ihn im Folgenden umso mehr zu durchdringen. Nach ihrem Willen. In ‚The Ark Work‘ schwappt ein Piranhabecken seuchenhaft wuchernden Schalls: Wer eintaucht, wird zerfetzt. Dröhnen war einmal, das neue High schellt, klirrt und klingelt sich in die Gehirnwindungen, dass Zähne knirschen und Knochen mahlen – im Gleichschritt mit dem Blastbeat, durchzogen von Glitches und anderen elektronischen Widrigkeiten. Inmitten des Ganzen thront Triple-H und befruchtet das Chaos mit delirischen Wortströmen und Stoßgebeten des Wahnsinns, die den Hörer in seiner intellektuellen Unzulänglichkeit absaufen lassen. Mit ‚Vitriol‘ kippt das Gebilde unter zähflüssigen Bässen Richtung Mantra-Rap, ‚Quetzalcoatl‘ wirft eine Splittergranate in die Genrelandschaft und der dudelsackbewehrte 10-Minuten-Bestie ‚Reign Array‘ lässt den Kessel vollends überkochen. Am Gipfelkreuz der Exzentrik wird dann nur noch in Haikus geredet:
‚Madrigal / Of the sun / Parted lips / Foreign tongue / GPS‘
(‚Total War‘).
Der Größenwahn der New Yorker wildert aggressiver denn je. Und doch: Dieses Scheusal von einem Album hat der Himmel geschickt – oder was auch immer Liturgy hinter dem Horizont, den sie Mal für Mal aufs Neue durchstoßen, zu entdecken glauben. Konvention und Stilistik gesellen sich zum Verstand, denn auch sie sind bezwungen und gesprengt. Das Überlegenheitsgefühl, es könnte kaum berechtigter sein. So bleibt einem am Ende nur der Kniefall: Black Metal ist tot. Lang lebe Black Metal!