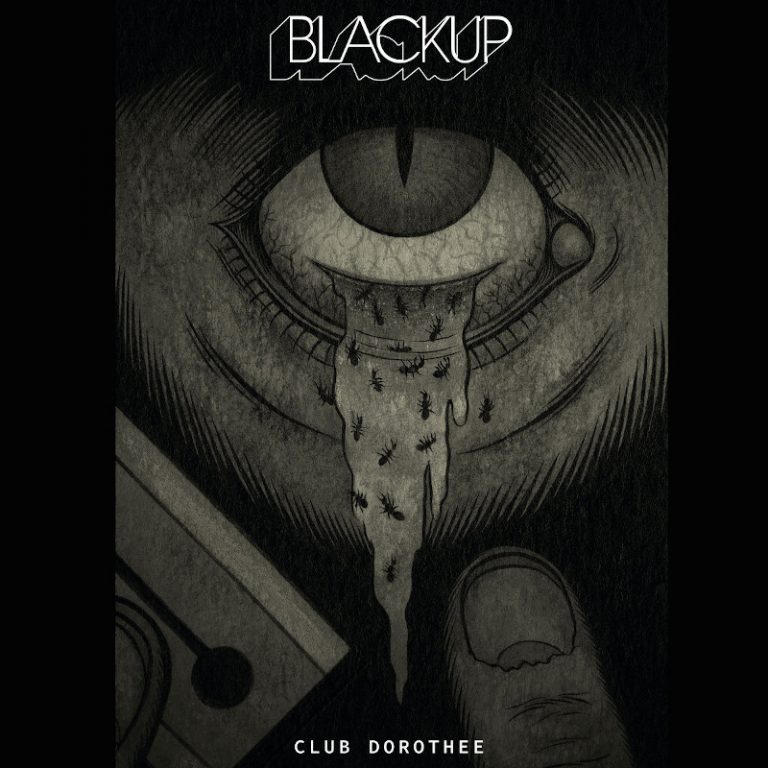Hitparade

Wieviele Genres wurden denn eigentlich schon als tot deklariert? Heavy Metal, natürlich. Death Metal. Black Metal. Metalcore. Punk.
Den Neofolk hat es nun vor kurzem auch erwischt. Gerade unter puristischen Erzkonservativen ist das allerdings nicht unbedingt etwas Schlechtes. Denn heutzutage ist in fast jedem eher anspruchsvollen Musikgenre die Definition „tot“ gleichbedeutend mit Stagnation. Stagnation ist allerdings etwas, das im kleinstmöglichst gefassten Kreis des „echten“ Neofolk stellenweise eher als Kompliment aufgefasst wird denn als Kritik. Das Genre wird seit Jahren von denselben Helden dominiert. Die Speerspitze, Jerome Reuter und Rome, sind mittlerweile schon so lange dabei, dass sie, die einst proaktiver Vorreiter für Neues waren, selbst zum Establishment gehören.
Das ist Stagnation auf allerhöchstem Niveau, ja, aber die neuen, andersartigen Ideen, die fehlen. Wenn man das Genre weiter fasst und all die folkloristischen Bands von Horse Cult bis Sangre De Muerdago mit ins Genre einbezieht mag die Sache anders aussehen. Der klassische Neofolk mit akustischen Gitarren, Samples und Gesang, den Death in June als Koryphäe so begeisternd machten hat jedenfalls schon länger nichts wirklich Kreatives hervorgebracht.
Umso seltsamer mag es anmuten, wenn man jetzt – und das sollte, nein, MUSS man – mit Death in Rome ein Zugpferd einer goldenen Zukunft sieht, das nicht einmal über eigene Songs verfügt. Wenn es im Neofolk nämlich etwas nicht gab, dann die übermäßige Abnutzung bekannter Genreperlen durch Coverversionen – geschweige denn das Nutzen weltweit berühmter Popsongs. Genau das ist es aber, was Death In Rome auf ihrem korrekterweise als „Hitparade“ betitelten Debutalbum tun. Nun gut mag man denken, ein Stück wie das – übrigens von den Fans per Voting durchgesetzte – traurige, langsame „Summertime Sadness“ von Lana Del Rey mag im neofolkloristischen Gewand sicherlich gut wirken – und das tut es auch, und wie! – wirklich grandios sind aber aber die Stücke, die weiter entfernt von Allem, wofür Neofolk steht, nicht sein könnten.
Zunächst muss man aber kurz auf den Stil von Death In Rome eingehen – wie der Name, so der Klang, eine Mischung aus tiefem, klaren, sehr vollen Gesang, düsteren Akustikgitarren, marschähnlicher Percussion und einigen genretypischen Sound-Elementen wie Schallplattenkratzen oder verzerrten Lautsprecheraufnahmen. So gut wie geniale Stücke von Rome, so herausragend wie Death in June zu besten „But, What Ends When The Symbols Shatter?“ – Zeiten.
Doch was machen Death In Rome mit dieser klassischen Ausrichtung? Sie brechen Konventionen auf, sie mischen Dinge, die sich abstoßen, sie bringen, und das ist gerade für dieses Genre so wichtig, ein Augenzwinkern mit. Sie schaffen es perfekt, die Balance zu halten zwischen ernsthaftem Herangehen an den Neofolk und dem Respekt für musikalische Originale, selbst für solche, die im Ohr anspruchsvoller Hörer eigentlich kaum Respekt verdient haben. Miley Cyrus‚ „Wrecking Ball““zum Beispiel klingt als wäre es nie anders gedacht als so, wie Death In Rome es machen.
Bei diesem Album bleibt einem der Mund offen stehen, mit einer kaum erklärbaren Mischung aus Freude, Respekt, Begeisterung und Unglauben, die vermutlich am Besten mit „Ja wie GEIL ist DAS denn??“ umschreibbar ist. Man hält sich an die Konvention der genreüblichen Getragenheit und der marschrhythmusdominierten Langsamkeit und wählt viele Originale aus passendem Geschwindigkeitsbereich.
Am unfassbarsten werden Death In Rome aber dann, wenn sie Originale nutzen, die weiter vom Genre nicht sein könnten, und schaffen es dabei mit einer Leichtigkeit die Könige des Aus-dem-Kontext-Reissens – Laibach – zu übertrumpfen. Death in Romes Version von „Barbie Girl“ jedenfalls erweitert das jawiegeil? um eine gehörige Portion kanndochgarnichtwahrsein. Haddaway und „What is Love“ steht dem wenig nach, und die Totenrunde „Destroy She Said“ (Murphy), „Wonderful Life“ (Black) und „Love Me Forever“ (Motörhead) zeigt Death In Rome auch bei Ehrerweisungen in Hochform. Was haben wir noch? Ein überragendes „Love Is a Battlefield“, A-ha und „Take On Me“, ein zum Heulen gutes „Careless Whisper“ von Wham, und die gestörteste Idee schlechthin – „Pump Up the Jam“, noch so ein kanndochgarnichtwahrsein-Track, der den Rhythmus über den Sound von Marschstiefeln trägt. Solche Elemente gibt es im Dutzend, wer gute Kopfhörer sein Eigen nennt, dem wird ein Panoptikum an Genialitäten eröffnet.
Einziger, wirklich einziger kleiner Wermutstropfen ist, dass die zu den Anschlägen in Paris veröffentlichte Version von Noir Desir’s „Le Vent Nous Portera“ den Weg nicht auf CD gefunden hat.
Ansonsten ist das hier klipp und klar das Album des Jahres.