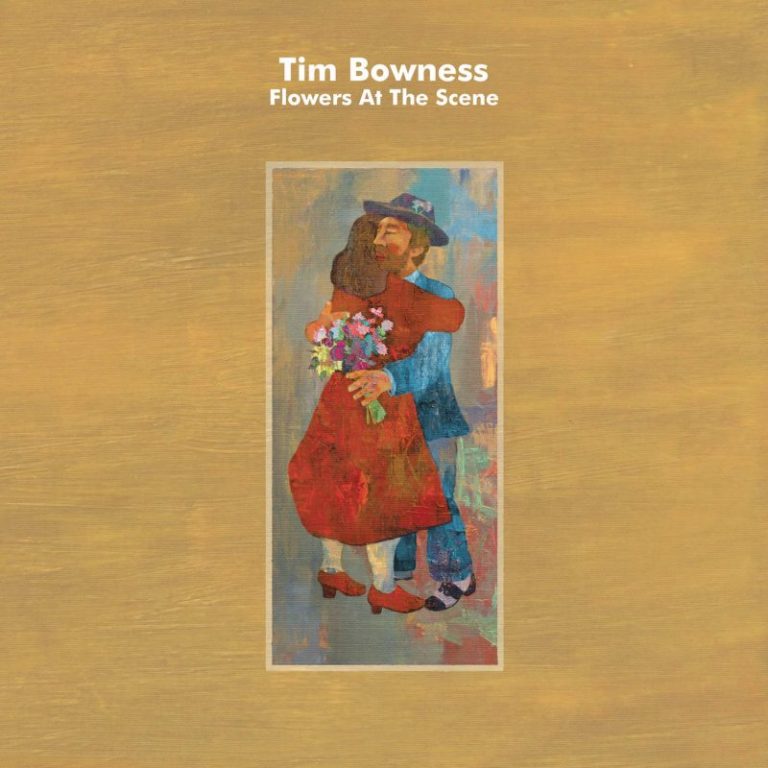If/When
Da haben es die New-Jersey-Progger (?) The Tea Club doch tatsächlich geschafft, bislang erfolgreich vor diesem Rezensenten zu verstecken, obwohl „If/When“ bereits das fünfte Studiowerk der Band darstellt. Wie dem auch sei, ab sofort stehen die Jungs definitiv auf der „Geilomat“-Liste. „If/When“ ist, kurz gesagt, moderner Artrock mit Folk-, Alternative- und Prog-Einflüssen. Ein wenig Leprous…