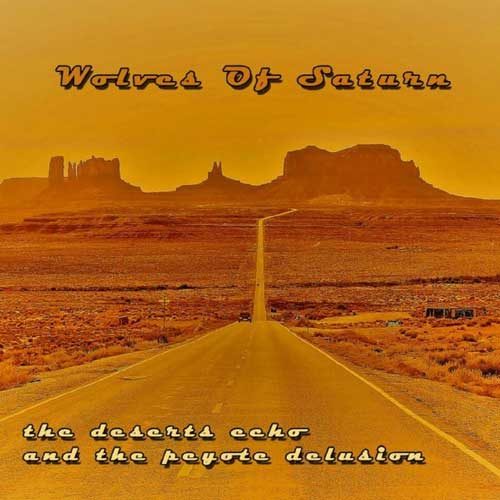PYRAMID – Beyond Borders Of Time
„Beyond Borders Of Time“ (Subsound Records) ist der mystische Titel des zweiten Longplayers des Nürnberger Trios Pyramid. Jenseits der Grenzen der Zeit gibt es rein instrumentalen psychedelischen Stoner-Rock und Doom auf die Ohren, wenn Bass- und Synthplayer Michael Kümpflein, Schlagzeuger Lukas Schormann und Shane Saban an der Gitarre loslegen. Psych, Fuzz, doomige Parts, das Baugerüste…