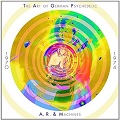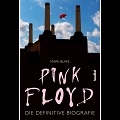A Collection Of Great Dance Songs – 2017 Vinyl Remaster
Die Vinyl-Reissues des Pink Floyd-Backkataloges kann man getrost als vorbildliche Beispiele einer solchen Unternehmung werten. Erstklassige Pressqualität, originalgetreue und hochwertige Reproduktionen der ikonischen Artworks sowie erfreulich vernünftige Preisgestaltung sorgten dafür, daß die schwarzen Scheiben schlicht zu perfekten Alternativen für alle Vinylsammler wurden, die nicht gewillt waren, Fantasiepreise für eine halbwegs ordentlich erhaltene Originalauflage zu zahlen….