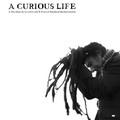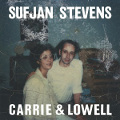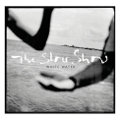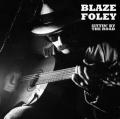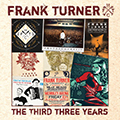Primrose Green
Hier sind die Vorbilder hoch gesteckt: Irgendwo zwischen Van Morrison und Nick Drake liegt das 70er-Jahre-angehauchte Gitarrenspiel von Ryley Walker. Nur sein starker amerikanischer Akzent verrät, dass der 25-jährige Singer-Songwriter nicht der britischen Folkschule entschlüpft ist, sondern die Chicagoer Blues-Kneipen sein zu Hause nennt. Ein junger Mann, der soundtechnisch nicht aus dieser Zeit zu sein…